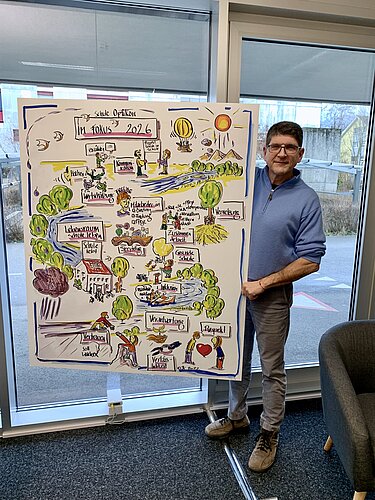«Verbringen Sie Zeit mit Ihren Kindern!»
Ende Jahr ist Schulpräsident Norbert Zeller zurückgetreten. In seiner Amtszeit sei 2014 ist die Schule Opfikon enorm gewachsen, von 1400 auf 2400 Schülerinnen und Schüler. Es brauchte zusätzliche Schulhäuser, Lehrkräfte und neue Organisationsformen, um dem zu begegnen.
Interview: Roger Suter
Norbert Zeller, was kommt Ihnen als Erstes in den Sinn, wenn Sie an Ihre 10 Jahre im Amt zurückdenken?
Veränderungen, Wandel, Wachstum, Herausforderungen; und auch viele Gespräche mit guten Menschen; Menschen, welche ich fördern und begleiten durfte. Die Zeit war für mich eine Reise mit ständigem Lernen. Für viele Herausforderungen gab es keinen Plan, sondern nur ein schrittweises Vorgehen. Über alles konnte ich mich immer darauf verlassen, dass sich alle an dieser Schule über Massen engagierten. Ich bin von Herzen dankbar, Teil dieser Reise von 1400 Schülern und Schülerinnen auf 2400 und von 3 auf 6 Schulanlagen mit heute über 500 Mitarbeitenden gewesen zu sein.
Welches waren die Highlights?
Dass wir jede Volksabstimmung in Schulbelangen gewonnen haben; die Bevölkerung hat jeweils Ja gesagt, trotz zum Teil kritischer Fragen und Gegenwind aus den Parteien, was mich freut.
Welches waren die Misserfolge?
Trotz meiner Bemühungen, in der Politik und der Öffentlichkeit zu vermitteln, in welchem Wandel die Schule ist und welche herausfordernden Aufgaben sie heute im Vergleich zu früher erfüllen muss, habe ich festgestellt, dass ich dieses Verständnis nicht überall wirklich vermitteln konnte. Das hat mich mit der Zeit ermüdet. Ein wichtiger Punkt zur Verbesserung ist daher: Kommunikation kann gar nicht intensiv genug sein. Es ist entscheidend, dafür ausreichend Zeit zu investieren – sowohl für die Schulpflege im Allgemeinen als auch für den Präsidenten im Besonderen. Möglicherweise habe ich in diesem Bereich nicht immer genug getan.
Was ist in Opfikon einfacher: auf Beginn des Schuljahres alle Stellen zu besetzen oder ein neues Schulhaus zu bauen?
Eine gute, schwierige Frage ... Im Bereich Lehrpersonen hat man Alternativen. Wenn jemand fehlt, gibt es Vikariate (temporäre Vertretungen, Anm. d. Red.). Ein Schulhausprojekt verzögert sich, wenn es nochmals zur Abstimmung kommt. Über alles denke ich: Der Schulhausbau ist schwieriger, komplexer und anstrengender.
Sie haben aber doch einiges auf den Weg gebracht: Glattpark ist nun doch gebaut, Bubenholz ist im Bau, Mettlen wird ab Mitte nächsten Jahres saniert.
Was oft unterschätzt wird: Schon bevor im Stadtrat jeweils eine Objektbaukommissionen gegründet wird, braucht es ganz viel Vorarbeit der Schule. Wir können nicht mehr einfach bei der Abteilung Finanzen und Liegenschaften eine Anzahl Klassenzimmer bestellen, die dann gebaut werden. Heute zählen auch pädagogische Herausforderungen wie: Was soll ein Raum bewirken und wie wird dieser Raum genutzt? Wenn man die Schulhäuser Oberhausen, Glattpark, Bubenholz und das dereinst sanierte Mettlen vergleicht, sieht man, dass sich Pädagogik und Architektur immer mehr gemeinsam entwickeln. Bei der Halden-Sanierung und -Erweiterung haben wir x Räume bestellt, das Architekturbüro hat geliefert, was bestellt wurde. Beim Bubenholz gab es von Beginn an eine Kollaboration zwischen Schule und Architektur. Diese Entwicklung innert 10 Jahren zu sehen, hat mir enorm Freude gemacht.
Ist dieses Zusammenspiel eine Opfiker Spezialität oder arbeitet man auch in anderen Schulgemeinden so?
Ich war im Vorstand der Schulpräsidenten des Bezirks Bülach und im Verband der Zürcher Schulpräsidenten aktiv und hatte diverse interessierte Schulpräsidenten und -präsidentinen wie auch Vertreter der Pädagogischen Schule hier, welche sich für diesen Prozess im Bubenholz interessierten. Denn ein solches Wachstum in so kurzer Zeit wie in Opfikon gab es sonst fast nirgends.
«Es gibt Kinder, die essen am Mittagstisch nichts, weil sie nebenbei kein Filmchen sehen können.»
Als Sie anfingen, besuchte und kontrollierte die Schulpflege noch den Unterricht. Wo stand die Schule damals?
Es waren drei Schulanlagen, neun Schulpflegerinnen und Schulpfleger, es gab keine «Leitung Bildung» und ich war von Amtes wegen operativ verantwortlich. Inzwischen ist die Schule von 1400 auf 2400 Schülerinnen und Schüler gewachsen, die Organisation ist von über 300 auf über 500 Mitarbeitende angewachsen, wir haben die neue Organisation mit einer operativen Leitung Bildung und ihren Schulleitungen/Dienststellen, ähnlich wie die Stadt mit den diversen Abteilungen der Stadtverwaltung entwickelt und parallel dazu die Schulpflege auf sieben Personen verkleinert.
Wo wollten Sie mit der Schule hin?
Wir hatten keinen genauen Plan, wenn Sie das meinen, den man einfach ausführt. Wir absolvierten vielmehr wie schon gesagt eine Lernreise: Wir überlegten uns, was wir machen könnten, und taten einen ersten Schritt. Funktionierte er, folgte der nächste. So kamen wir zum pädagogischen Konzept: Altersdurchmischten Lernen (AdL, praktiziert im Schulhaus Oberhausen – heute Glattpark), das etwa Zumikon nach heftigen Diskussionen 2016 wieder abschaffte. Aber wenn wir Lehrpersonen haben, die sich dafür begeistern und engagieren, ist das Konzept eine gute Antwort auf die Heterogenität in unserer Schule.
Das heisst, man probiert in Opfikon weiterhin mehrere Konzepte?
Wir entscheiden uns ganz bewusst zusammen (Schulpflege, Schulleitung, Lehrpersonen) für ein bestimmtes Konzept. Für jedes finden wir überzeugte Menschen, die das umsetzen wollen. Und es ist empirisch bewiesen: Ob in einer AdL-Schule oder in einem anderen Konzept – das Lernziel wird in beiden Systemen erreicht, wenn die Beziehung zwischen Kind und Lehrperson funktioniert. Dies ist das Wichtigste. Und weil wir diverse Unterrichtsmöglichkeiten bieten, finden wir immer wieder engagierte Pädagoginnen und Pädagogen, trotz Fachkräftemangel.
Dann sind die verschiedenen Unterrichtsmodelle gar nicht in erster Linie für die Schüler, sondern für die Lehrer?
Der Erziehungsspezialist Remo H. Largo sagte: «Die Kinder leben im 21. Jahrhundert, die Eltern und Lehrpersonen sind aus dem 20. Jahrhundert und das Bildungssystem stammt aus dem 19. Jahrhundert.» Also erfordert dies ein Umdenken. Wir brauchen Modelle, welche den Kindern im 21. Jahrhundert gerecht werden. Im aktuellen System bewilligt das Volksschulamt bei Klassen mit unterschiedlichen Bedürfnissen einen Heilpädagogen, eine Lehrerin für Integrative Förderung (IF), eine für Deutsch als Zweitsprache (DaZ), eine Klassenassistenz, vielleicht einen Sozialpädagogen ... Dadurch geht aber für Absprachen und Administration viel Energie verloren, die nicht dem Kind zugutekommt.
Derzeit laufen verschiedene Organisationsformen in Opfikon ja parallel. Bleibt das so oder einigt man sich irgendwann auf das am besten geeignete Modell?
Die meisten Schulgemeinden im Kanton Zürich entsprechen in der Grösse einem einzigen Opfiker Schulhaus. Unsere fünf – ab kommendem Sommer sechs – Schulanlagen lassen es zu, dass man divers denken und agieren kann. Die Leute bewerben sich auch nicht für die Schule Opfikon, sondern für ein bestimmtes Schulhaus. Und das ist auch gut so.
Wie laufen die verschiedenen Modelle?
Jede Schule ist für sich auf einem sehr guten Weg: Das Modell AdL hat in Oberhausen gestartet und ist in den Glattpark umgezogen. Es macht richtig Freude zu sehen, wie das Modell bei Team und Schulleitung gefruchtet hat – übrigens auch zur grossen Zufriedenheit von Schülern und Eltern. Die Gesamtschule Oberhausen wächst noch und wird nächstes Jahr mit den letzten zwei Oberstufenklassen erstmals komplett. Am Adventssingen («Stadt-Anzeiger» vom 19. Dezember) waren vom Kindergärtler bis zur Sekschülerin alle dabei – dieser Zusammenhalt war herzerwärmend. Lättenwiesen ist stabil und gut unterwegs. Die Sekundarschule Halden wächst noch immer und die wichtigen Themen – die Beziehungen zwischen Lehrpersonen und Jugendlichen respektive die Elternzusammenarbeit – sind weiterhin im Fokus. In der Schulanlage Mettlen ist ganz viel im Umbruch, denn ein Teil des Teams wird im Sommer ins neue Bubenholz wechseln. Dieser Prozess ist sehr komplex und aufwendig. Ich freue mich zu sehen, dass die ganze Schule engagiert in diesem Prozess involviert ist.
Wie geht die Schule heute mit der kulturellen Vielfalt um? Haben Sie während Ihrer Amtszeit neue Erkenntnisse gewonnen?
In Opfikon werden möglicherweise über 50 Sprachen gesprochen, über 85 Prozent der Schulkinder reden daheim nicht Deutsch. Unsere Herausforderung ist aber nicht die Vielfalt an Sprachen, sondern dass die Eltern daheim (zu) wenig mit ihren Kindern aktiv reden – egal in welcher Sprache. Wir wissen, dass die Basis für die sozial-emotionale Kompetenz eines Kindes massgeblich in den ersten vier Jahren, also vor der Schulzeit, gelegt wird. Wir stellen fest, dass da viele Kinder Defizite haben und so in der Gruppe im Kindergarten Schwierigkeiten haben. Mein Wunsch und meine Einladung an alle, die Kinder haben (wollen): Reden Sie mit Ihren Kindern in Ihrer Landessprache, verbringen Sie viel Zeit mit ihnen (und nicht mit dem Smartphone), gehen Sie raus mit ihnen – das hilft Ihren Kindern am meisten. Es gibt keine bessere Unterstützung Ihrer Kinder. Denn was in den ersten Lebensjahren nicht mit eigenen Sinnen erfahren wurde, kann man auch mit viel Zeit und Geld nicht mehr wettmachen. Das ist einer der Gründe, warum die Schule immer teurer wird – bei wie gesagt mässigem Erfolg. Die Unterstützung der Eltern kleiner Kinder ist deshalb auch eine wichtige Aufgabe der Stadt.
Welche Art der Unterstützung schwebt Ihnen da vor?
Wir betreiben bereits Spielgruppen mit Deutschförderung und Elternbildung. Das sollten die Eltern mehr nutzen. Wir haben letztes Jahr eine gut besuchte Infoveranstaltung mit Angeboten für alle Eltern von Kleinkindern gemacht («Stadt-Anzeiger» vom 11. April 2024). Wie aber erreichen wir die etwa 90 Eltern, die nicht gekommen sind? Wir haben uns in der Schulpflege sogar überlegt, vorbeizugehen und sie einzuladen – nicht, um Druck aufzusetzen, sondern um es persönlich zu tun.
Also Eltern- statt Schulbesuche?
Vielleicht müssen wir wirklich so das Gespräch suchen.
Ihr Punkt, sich mehr mit den Kindern zu beschäftigen, wird mit all den neuen Medien aber sicher schwieriger.
Das ist kein Schul-, sondern ein gesellschaftliches Thema. Heute sind die sozialen Medien die Nummer 1, nicht mehr die Zeit mit der Familie wie vor 20, 30 Jahren. Wir haben als Menschen noch gar nicht abschliessend realisiert, was das mit uns macht. Ein soziales Medium reagiert nicht wie ein menschliches Visavis. Und das merken wir in der Schule. Es gibt hier Kinder, die essen am Mittagstisch nichts, weil sie nebenbei kein Filmchen sehen können. Deshalb frage ich mich: Sollten wir den Zugang zu sozialen Medien für Kleinkinder reduzieren oder gar unterbinden?
Die Wirtschaft klagt immer wieder, Schulabgängerinnen und -abgänger könnten zu wenig. Teilen Sie diese Ansicht?
Grundsätzlich glaube ich auch, dass wir in der Schule immer mehr Ressourcen investieren, der «Outcome», das Resultat aber nicht besser wird. Das liegt aber auch daran, dass schon bei Schulbeginn besagte Defizite vorliegen. Keine Schule und kein Staat können garantieren, dass ein Kind später an die Uni geht. Diese Erwartung gibt es aber in manchen Kulturen: Der Staat kümmert sich um die Kinder. Diese Entwicklung hat mich als Schulpräsident auch immer angetrieben. Ich bin überzeugt, dass die Eltern gemeinsam mit der Schule mehr erreichen könnten. Und dazu haben wir an der Schule in verschiedenen Initiativen die Haltung der neuen Autorität, wo Präsenz und Beziehung aller Beteiligten (Eltern und Schule) gelebt werden, eingeführt. Erste kleine Erfolge sind sichtbar.
Auch die Berufswelt ist im Umbruch. Wie kann die Schule überhaupt auf Jobs vorbereiten, die es heute noch gar nicht gibt?
Der Lehrplan 21 per se fördert Kompetenzen. In Zukunft sind Kompetenzen wie kritisches Denken und Problemlösung, digitale Kompetenz und Datenverständnis sowie Kreativität und Innovationsfähigkeit von zentraler Bedeutung. Mit der Investition in die Digitalisierung haben wir hier einen grossen Schritt gemacht. Die Umsetzung und Anwendung der digitalen Mittel sind fortgeschritten. Zur weiteren Förderung der Kreativität haben wir auch den sogenannten «Makers space», eine Art «Werkunterricht plus», geschaffen. Hier können die Jugendlichen ihre Individualität und Kreativität weiterentwickeln und ihre Stärken erkennen. Wir müssen den Fokus darauf halten, diese zu fördern.
Die Coronapandemie war auch für die Schule eine grosse Zäsur. Welche Lehren ziehen Sie daraus?
Zuerst ein grosses Dankeschön an den Gemeinderat, der schon vorher die Investition in Tablet-Computer und Rechner genehmigt hatte; das hat uns gerettet. Wenn es hart auf hart kommt, können Menschen miteinander schnell etwas bewirken. Diese Kraft zu erkennen war wunderbar. Aber die Kinder jener Zeit kommen jetzt in den Kindergarten, und wir haben bei manchen deutliche Veränderungen festgestellt – etwa Sprachstörungen und einen Rückstand bei der sozialen Kompetenz, weil sich die Menschen damals zu sehr zurückzogen. Das werden wir mit allem Geld nicht mehr aufholen können, und das ist tragisch.
Und was macht KI in beziehungsweise mit der Schule?
Wir tun gut daran, die digitalen Kompetenzen zu entwickeln, aber auch die Diskussion über moralische Werte und Prinzipien zu führen. Wenn wir das tun, ist KI eine sehr gute Unterstützung und auch Entlastung in vielen Bereichen unseres Lebens und im Speziellen in der Schule. KI ersetzt Lehrpersonen nicht, sondern unterstützt und ergänzt den Unterricht, indem sie Lernen effizienter, flexibler und interaktiver macht. Und Eigenverantwortung wird eine absolute Schlüsselfähigkeit bleiben, die keine KI übernehmen kann. Für diejenigen, die das erkennen, ist sie eine riesige Chance. Und deshalb muss die Schule die Stärken und Kreativität der Jugendlichen weiter stärken.