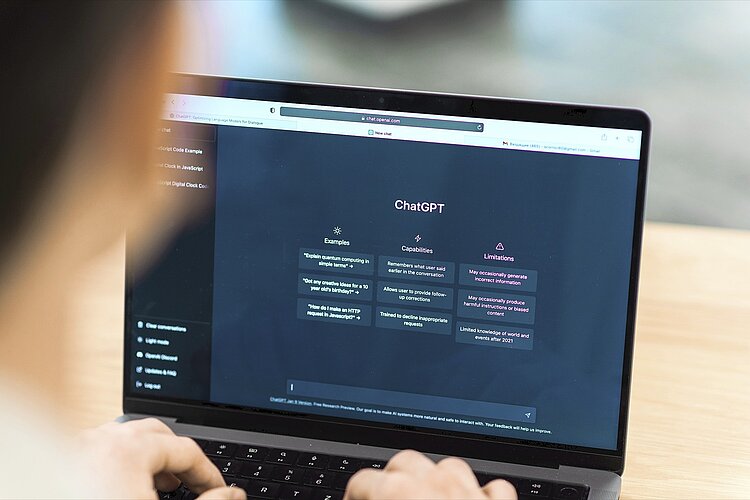Wie Kloten, Opfikon und Wallisellen KI nutzen
Über hundert Millionen Menschen nutzen täglich künstliche Intelligenz. Auch in den Verwaltungen ist die Technologie angekommen. Der Blick in die Flughafenregion zeigt, wie unterschiedlich die Städte mit «ChatGPT» und Co. umgehen.
Mit dem Start von «ChatGPT» des US-Unternehmens «OpenAI» im November 2022 begann ein neues digitales Zeitalter. Innerhalb von fünf Tagen nutzten bereits über eine Million Menschen den Chatbot, im Januar 2023 waren es 100 Millionen. Plötzlich war künstliche Intelligenz (KI) nicht mehr nur ein Thema für Forschungsinstitute und Tech-Konzerne, sondern Teil unseres Alltags. Texte schreiben, Informationen verdichten oder Bilder generieren — all das wurde mit einem Mal für breite Kreise möglich. Inzwischen sind weitere KI-Chatbots auf den Markt gekommen. Wie gehen die Stadtverwaltungen der Flughafenregion mit der künstlichen Intelligenz um?
Wallisellen prüft Protokolle
Im Stadthaus in Wallisellen kommt KI bislang nur punktuell zum Einsatz. «Vereinzelt nutzen wir Chatbots für die Formulierung von Texten oder die Erstellung von Bildern», sagt Marcel Amhof, Kommunikationsverantwortlicher der Stadt Wallisellen.
Grössere Projekte oder Pilotversuche laufen derzeit nicht. Die Verwaltung testet jedoch Programme, die automatisch Sitzungsprotokolle erstellen. Ein weitergehender Einsatz müsste mit der kantonalen Datenschutzstelle abgestimmt und vom Stadtrat genehmigt werden. Obwohl KI nicht systematisch eingesetzt wird, sei der Umgang mit entsprechenden Programmen in den Informatik-Benutzerrichtlinien geregelt. «Es dürfen keine vertraulichen oder personenbezogenen Daten übermittelt werden. Vorschläge von KI müssen überprüft werden, und KI-generierte Bilder sind als solche zu kennzeichnen», sagt Amhof. Zusätzlich gebe es eine Zugriffsbeschränkung auf das Internet, die eine weitere Sicherheitsschwelle bilde.
«KI ersetzt keine Verwaltungsangestellte, sondern entlastet sie bei ihrer Arbeit.»
Ein ausdrückliches Verbot einzelner Programme gibt es nicht – auch nicht von Angeboten aus bestimmten Ländern wie dem KI-Chatbot «DeepSeek» aus China. Der stellvertretende Stadtschreiber sagt dazu: «Die Installation neuer Software erfolgt bei uns zentral über den Bereich Informatik. Eingesetzt wird nur, was vorgängig geprüft und als unbedenklich befunden wurde.»
Kloten setzt auf Schweizer KI
Konkreter ist der Stand in Kloten. Dort laufen mehrere Pilotprojekte. Derzeit testet die Stadt etwa «SwissGPT» der Schweizer Firma «AlpineAI». «Wir wollen prüfen, in welchem Umfang uns solche Systeme nützen», sagt Ruedi Ulli, Bereichsleiter Finanzen und Logistik. «Die Auswertung des Pilotversuchs mit ‹SwissGPT› wird zeigen, ob und in welcher Form wir KI in Zukunft einsetzen», sagt er. Ob KI künftig stärker genutzt wird, hängt von den Ergebnissen dieser Projekte ab. Ein weiterer Test betrifft die Überprüfung von Baugesuchen (siehe Box). Bereits 2022 sammelten Kadermitarbeitende der Stadt im Rahmen einer Kaderklausur erste Erfahrungen mit «ChatGPT». «Das bedeutet aber nicht, dass ‹ ChatGPT› bei der Stadt Kloten offiziell genutzt wurde oder wird. Es handelte sich lediglich um Laborversuche in einem klar abgesteckten Rahmen», sagt Ulli.
Die Regeln in Kloten seien streng. Die bestehenden Datenschutzvorschriften und internen Weisungen würden den Einsatz einschränken. «Eine spezielle Weisung zur Nutzung von KI ist derzeit in Erarbeitung», sagt Ulli. Ein ausdrückliches Verbot existiere jedoch nicht. Auch in Kloten gebe es kein Verbot für den chinesischen Chatbot «DeepSeek». «Jede Nutzung muss jedoch den bestehenden Reglementen und Gesetzen entsprechen, was vieles ausschliesst», sagt der Bereichsleiter Finanzen und Logistik.
Opfikon: Erst Schulung, dann Einsatz von KI
In Opfikon habe KI einen hohen Stellenwert, heisst es auf Anfrage aus dem Stadthaus. «Die Stadtverwaltung Opfikon setzt sich intensiv mit dem Thema KI auseinander. Interne Richtlinien zur Nutzung von KI und Clouddiensten sind bereits vorhanden», sagt Stadtschreiber Guido Zibung. In der nächsten Zeit fänden zudem Schulungen für die städtischen Mitarbeitenden statt. Eine offizielle Nutzung von KI-Diensten sei erst danach vorgesehen. «Dabei ist für uns ein rechtskonformer Einsatz von KI unter Berücksichtigung des Datenschutzes zentral», sagt Zibung.
KI-Stelle für Zürcher Gemeinden
Anlaufstelle für die Zürcher Städte und Gemeinden im Umgang mit KI ist «egovpartner», eine spezielle Koordinationsstelle für die öffentliche Hand. Dort sei eine Umsetzungshilfe zu generativer KI erarbeitet und eine Austauschplattform für Städte und Gemeinden geschaffen worden. Derzeit laufe das Projekt «Nutzung und Skalierung KI-Basisdienste». Ziel sei es, ein Grundangebot von Anwendungen auf einer gemeinsamen Infrastruktur bereitzustellen. Im Herbst 2025 solle die Ausschreibung eines Rahmenvertrags erfolgen, im ersten Halbjahr 2026 könne die Umsetzung mit ersten Pilotgemeinden starten.
Auf der geplanten Plattform sollen in erster Linie Open-Source-Lösungen – etwa vom Kanton Zürich entwickelte Anwendungen sowie zusätzliche Dienste des ausgewählten Anbieters bereitgestellt werden.
KI ist ein «No-Brainer»
Einer, der sich seit Jahren mit Künstlicher Intelligenz beschäftigt, ist Thilo Stadelmann. Er ist Professor für Artificial Intelligence and Machine Learning an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschafen ZHAW und leitet dort das Centre for Artificial Intelligence. Neben seiner Tätigkeit in Forschung und Lehre ist er zudem Vorstandsmitglied beim von ihm mitgegründeten Unternehmen «AlpineAI», das unter anderem den Schweizer Chatbot «SwissGPT» entwickelt hat.
«KI ist mehr als nur ‹ChatGPT›. Aber gerade für textbasierte Aufgaben können solche Systeme eine enorme Hilfe sein», sagt der KI-Experte. Ob bei der Bearbeitung von Formularen, bei Übersetzungen oder beim Auffinden alter Stadt- und Gemeinderatsbeschlüsse – das Potenzial sei riesig, so der KI-Experte. Auf die Frage, ob öffentliche Verwaltungen KI einsetzen sollten, sagt er: «Ja, das ist ein No-Brainer. Man muss KI nutzen, sonst wäre es ein ineffizienter Umgang mit den öffentlichen Mitteln.»
«Wenn Verwaltungen kostenlose Accounts nutzen, können Daten direkt in die USA oder China abfliessen.»
Gleichzeitig warnt er vor Risiken. «Diese Systeme berechnen einfach Wahrscheinlichkeiten, sie können überzeugend Falsches ausgeben. Ein Fehler wäre es, die Mitarbeitenden unvorbereitet auf solche Tools loszulassen», sagt Stadelmann. Städte und Gemeinden müssten sichere Anwendungen bereitstellen und die Angestellten im Umgang damit schulen. «Alles andere wäre fahrlässig.»
Besonders kritisch sei für ihn der Datenschutz. «Wenn Verwaltungen kostenlose Accounts nutzen, können Daten direkt in die USA oder nach China abfliessen. Das wäre, als würde man sie öffentlich ins Netz stellen», sagt Stadelmann. Eine weitere Sorge sei die Angst vor Arbeitsplatzverlusten. Ob Angestellte in öffentlichen Verwaltungen künftig um ihre Jobs bangen müssten, verneint er und sagt: «Künstliche Intelligenz ersetzt keine Verwaltungsangestellten, sondern entlastet sie bei ihrer Arbeit.»
KI-Chatbots wie «ChatGPT» haben die Welt verändert und auch die Verwaltungen der Flughafenregion erreicht. Wallisellen prüft Protokolle, Kloten testet «SwissGPT» und ein Pilotprojekt zur Prüfung von Baugesuchen mit KI, in Opfikon stehen bald KI-Schulungen an. Bild Freepik
Pilotprojekt in Kloten: KI prüft Baugesuche
Die Überprüfung von Baugesuchen ist aufwendig: Kataster- und Projektpläne, Grundbuchauszüge, Lärmgutachten oder Berechnungen zur Ausnützung müssen kontrolliert werden. Diese Vielzahl an Dokumenten zu prüfen, beansprucht auf den Verwaltungen viel Zeit. In Kloten läuft deshalb ein Pilotprojekt, das die Stadt testweise gemeinsam mit der kantonalen Standortförderung umsetzt. Mit Hilfe multimodaler KI-Modelle soll ein Prototyp entwickelt werden, der Baugesuche automatisch überprüft – sowohl Textdokumente als auch Pläne. Ziel ist es, baurechtliche Vorgaben effizienter zu kontrollieren und die Arbeit der Bauämter zu erleichtern. Die aktuelle Testphase konzentriert sich vor allem auf die Analyse von Texten und die Vollständigkeit der Unterlagen. Pläne seien deutlich komplexer und könnten vorerst noch nicht automatisiert ausgewertet werden, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Die Ergebnisse des Pilotprojekts werden bis Ende 2025 erwartet. (ts.)